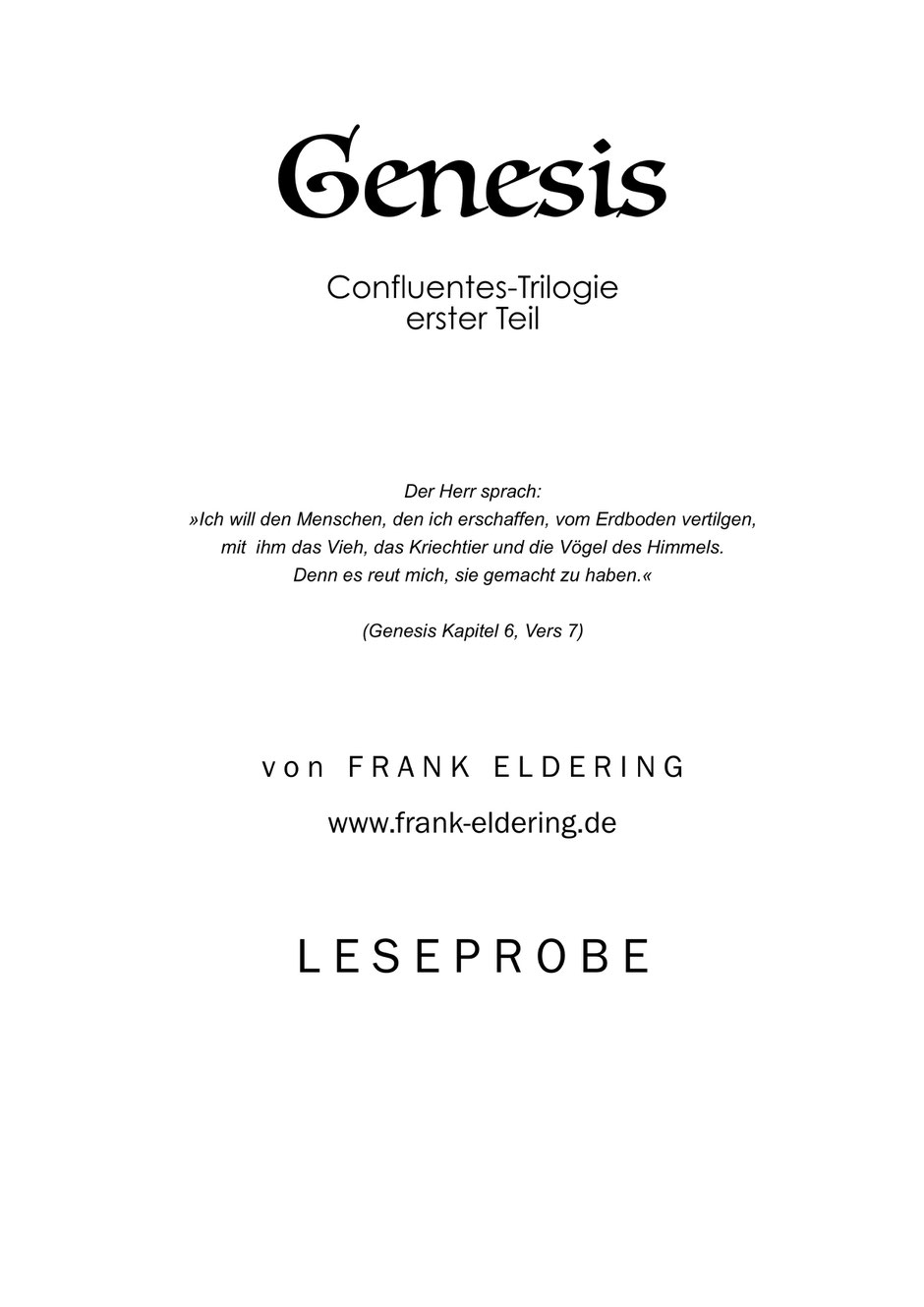

Kardinaldiakon Benedetto Gaetani, oberster Sonderbeauftragter der päpstlichen Inquisition, schritt in seinem Arbeitsgemach im Lateranpalast auf und ab. Immer wieder schaute er auf das Pergament, das sich im Licht der Mittagssonne grell gegen das Dunkel des Tisches abzeichnete.
Mit jedem Blick gruben sich die Sorgenfalten tiefer in seine Stirn.
Ein Menetekel?
Die bedrohlichen Nachrichten aus Palästina häuften sich. Der Antichrist war auf dem Vormarsch, hatte Jerusalem erobert und weite Teile des Heiligen Landes eingenommen. Jetzt streckte er die Finger nach den letzten Bastionen der Kreuzritter im Norden aus. Akkon, Tyros und Sidon waren dem Untergang geweiht.
Ein Klopfen an der Tür unterbrach seine Gedanken.
»Herein!«
Ein hagerer, hochgewachsener Mann mit schwarzem, nach hinten gekämmtem Haar betrat den Raum. Er war in einen langen, staubigen Reisemantel gehüllt.
»Da bist du endlich«, sprach Gaetani und streckte dem Eintretenden die rechte Hand entgegen. Der Mann küsste den Ring am mittleren Finger und legte seinen Mantel ab. Die rote Robe eines Kardinals der Inquisition kam darunter zum Vorschein.
Gaetani schloss die Tür.
»Ich danke dir, dass du gekommen bist, Salvatore. Nimm bitte Platz.« Er zeigte auf einen der beiden Sessel vor dem großen Kamin.
Der Kardinal setzte sich.
»Sei gegrüßt, Benedetto. Was ist so eilig, dass ich Hals über Kopf von Siena nach Rom reisen musste?«
»Tut mir leid, Salvatore, aber es ist wichtig ... sehr wichtig.«
Salvatore da Lucca hatte ein lang geplantes Treffen mit dem Bischof von Siena abgesagt und war sofort nach Rom aufgebrochen. Zu Pferd, statt mit dem Fuhrwerk. Er war müde. Doch er kannte seinen Dienstherrn. Wenn Gaetani sagte, dass etwas wichtig sei, dann war es das. Er schien in großer Sorge.
Da Lucca harrte gespannt, was er ihm enthüllen würde.
Nachdem Gaetani aufgehört hatte, zu reden, wartete da Lucca wie immer auf die Anweisungen des Kardinaldiakons.
»Du wirst ins Heilige Land reisen, Salvatore. Du weißt, was zu tun ist. Enttäusche mich auch diesmal nicht!«
Gaetani stand auf als Zeichen, dass das Gespräch beendet war. Auch da Lucca erhob sich und zog den Mantel über.
»In Civitavecchia liegt ein Schiff bereit, das dich nach Palästina bringen wird. Vierzig Tage sollten reichen. Ende Juli treffen wir uns hier wieder.«
Als da Lucca die Tür öffnen wollte, hielt Gaetani ihn zurück.
»Ein Letztes noch, Salvatore.« Der Blick des Kardinaldiakons bohrte sich tief in die Augen des Inquisitors. »Finde sie und bring sie hierher. Und stelle sicher, dass dort nichts fortbesteht. Gleichgültig wie.«
Da Lucca erwiderte den Blick. »Gleichgültig wie?«
Gaetani nickte kaum sichtbar. »Die Muslime rücken auf, bald wird die Festung fallen. Dann wird das Unheil zu uns kommen. Und das, mein lieber Salvatore, gilt es unter allen Umständen zu verhindern. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?«
Da Lucca verstand die Botschaft.
»Du kannst dich auf mich verlassen.«

Die Luft über dem mächtigen Wehrturm, dem Turm der Teutonen, flimmerte. Es war der dritte Sonntag im Monat August des Jahres 1290 und Wilhelm von Bolanden lief der Schweiß den Rücken hinunter. Er hatte den grauen Umhang des Ordensbruders abgelegt und schritt Runde um Runde die steinerne, mit Schießscharten versehene Umwehrung entlang. Er musste in Bewegung bleiben, denn langes Stehen auf dem heißen Steinboden würde ihm trotz Lederstiefel die Füße verbrennen.
Nach der Sext hatte er die Wache auf dem Turm übernommen, bis Vesper musste er ausharren. In der Ferne, am Strand im Hafen, planschten ein paar Knaben im Wasser herum.
Wie gerne würde ich das Gleiche tun!
Er blickte nach Osten. In der sengenden Hitze der Mittagssonne breitete sich die Ebene von Akkon vor ihm aus. Dort, wo Jahrhunderte lang Armeen der Muslime und Christen die Stadt abwechselnd belagert hatten, zog ein Trödler mit seinem Ochsenwagen eine Spur in den glühend heißen Boden. Die Tore der Stadt standen offen, ermöglicht durch den 1229 im Frieden von Jaffa ausgehandelten zehnjährigen Nichtangriffspakt zwischen Kreuzfahrern und Mamluken, an den beide Parteien sich bisher auch nach Ablauf der Frist gehalten hatten.
Ein brennender Schmerz an der Fußsohle unterbrach jäh seine Gedanken. Ohne es zu merken, war er stehen geblieben. Er setzte seine Runde fort, warf einen Blick über die Zinnen ins muslimische Viertel, das im Norden an die Bastion grenzte. Einige verschleierte Frauen liefen in der Gasse herum. Vom Kirchplatz im Westen drang Musik zu ihm empor. Eine Gruppe Männer, Frauen und Kinder saßen vor der Nikolauskirche zusammen und sangen Lieder. Wilhelm lächelte.
Er kannte die Bruderschaft aus Christen, Muslimen und Juden, die bis in die frühe Christenzeit zurückreichte. Ihr Ziel war, Menschen verschiedener Religionen in Frieden zu vereinen. Wilhelm hatte mehrere Male die Predigten des Anführers Manfred von Gerbrand angehört, Freundschaft mit ihm geschlossen und war der Bruderschaft beigetreten. Wenn es seine Aufgaben als Ordensbruder zuließen, sang er ab und zu mit ihnen.
Sein Lächeln gefror, als Gejohle zu ihm heraufstieg. Es schien aus der Gasse zu kommen, auf die er soeben hinuntergeschaut hatte. Er hastete die paar Schritte zurück zu der Stelle an der Mauer und sah hinunter. Kreuzfahrer polterten wankend durch die Gassen, pöbelten die muslimischen Frauen an. Männer stürmten aus den Häusern, versuchten, die Betrunkenen von den Frauen fernzuhalten.
Da geschah es: Einer der Pöbelnden zog sein Schwert, durchtrennte mit einem Hieb den Hals des Mannes vor ihm. Blut spritzte. Von überall her Geschrei, Steine flogen. Andere Betrunkenen zogen darauf ebenfalls ihre Schwerter und stürzten sich auf die Muslime.
Immer mehr Kreuzfahrer kamen hinzu. Wahllos schlugen sie auf die Wehrlosen ein. Männer und Frauen stürzten zu Boden. Bald war die ganze Gasse voller kämpfender Gestalten.
Wilhelm fiel eine Gruppe Kreuzfahrer auf, die keineswegs den Eindruck machten, betrunken zu sein. Sie beteiligten sich nicht am Kampf, bahnten sich mit gezogenen Schwertern gezielt einen Weg am Gemetzel vorbei und verschwanden in einer Seitengasse.
Was wollen die?
Er sprang die steinernen Stufen des Wehrturms hinunter, rannte zum Deutschen Haus, riss die Tür auf.
»Greift eure Waffen! Draußen werden Muslime von Kreuzfahrern gemeuchelt. Einige sind auf dem Weg zum Kirchplatz!«
Die Deutschritter strömten in die Gassen, folgten der Blutspur, welche die mordende Horde durch das muslimische Viertel zog. An der Seitengasse trennten sich Wilhelm, sein Bruder Heinrich, der oberste Marschall des Deutschen Ordens, und eine Handvoll Männer vom Rest der Deutschritter und folgten der Gruppe, die in Richtung Nikolauskirche verschwunden war.
Auf dem Kirchplatz war der Gesang verstummt.
Frauen, Männer und Kinder lagen niedergemetzelt auf dem Boden. Sie hatten keine Chance gehabt, zu fliehen.
Auf den Stufen vor der Kirche lag der Anführer Manfred von Gerbrand in einer Blutlache. Wilhelm kniete sich neben seinen Freund, drehte ihn um, sprach seinen Namen.
Manfred schlug die Augen auf, flüsterte ihm etwas zu. Wilhelm senkte den Kopf. Die Worte kamen stoßweise, mit Mühe konnte er die Wörter Schriften, Coblenz und Bruder Lothar heraushören.
Schriften, die nach Coblenz gebracht werden müssen? Zu Manfreds Bruder Lothar?
Er fügte noch etwas hinzu. Wilhelm musste sein Ohr an die Lippen des Sterbenden pressen, um es zu verstehen. »Drm...p...kr...ph...s.« Dann starb er.
»Ich verspreche es dir«, flüsterte er dem Toten zu. Er drückte ihm die Augen zu.
Was hat er gesagt? Es klang Griechisch, dermipekrephis, dermapikrephos?
Er richtete sich auf. Der Kampf war vorbei. Heinrichs Männer hatten einige der Angreifer auf dem Kirchplatz überwältigt und sie mit ihrem Anführer gefangen genommen. Sie führten sie ins Deutsche Haus und sperrten sie ein, um sie später zu verhören.
Heinrich ließ die toten Muslime und Juden von ihren Angehörigen abholen. Die Leichen der Christen wurden in einem Massengrab beigesetzt. Der Ordenspriester sprach ein kurzes Gebet.
Mit versteinerter Miene stand Wilhelm vor dem Grab. Die Worte des Priesters hörte er nicht. Ihn beschäftigte nur ein Gedanke: Die betrunkenen Kreuzfahrer hatten den Streit mit den Muslimen angefangen. Doch warum töteten, nein, massakrierten einige anscheinend nüchterne die Gruppe Menschen, die sich friedlich auf dem Kirchplatz abseits des muslimischen Viertels aufhielten?

In der noch dunklen Morgenstunde des 18. Mai 1291 stand Sultan al Ashraf Chalil mit seinen drei höchsten Offizieren am Rande des Zeltlagers, außer Reichweite der feindlichen Bogenschützen.
Ist es erst sechs Wochen her, seit ich dieses gewaltige Heer zusammenzog? Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor.
Mit der Hand am Griff des Krummschwertes wandte er sich den Männern zu.
»Dreht euch nach Osten. Was seht ihr?«
»Das Ende der Nacht«, antwortete einer von ihnen.
»Falsch, Said. Den Beginn eines neuen Tages. Seht euch die Tausende von Zelten an, die mächtigen Katapulte, die Belagerungstürme.«
Im Grau des Morgens waren die Kriegsgeräte nur schemenhaft zu erkennen.
»Jetzt dreht euch nach Norden. Was seht ihr?«
»Noch nichts, Chalil. Aber wir wissen, dass dort noch mehr Zelte, Belagerungstürme und Katapulte aufgestellt sind.«
»Richtig. Die unserer Verbündeten: vier syrische Armeen aus Damaskus, Tripolis, Hama und Al Karak. Jetzt dreht euch nach Westen. Was seht ihr?«
»Akkon«, klang es gleichzeitig aus zwei Kehlen.
»Die wichtigste Hafenstadt des Königreichs Jerusalem. Das Bollwerk der Kreuzfahrer.« Er spuckte auf den Boden. »Die meist umkämpfte Festung des Morgenlandes. Sie liegt auf einer Landzunge. Seht ihr den mächtigen doppelten Verteidigungswall? Vom Meer im Norden bis zum Hafen im Süden schirmt er die Stadt gegen die Landseite ab. Seht ihr, wie der hintere Wall den vorderen überragt? Wie die Gefechtstürme in den nächtlichen Himmel hineinragen? Wirken sie bedrohlich? Auf mich nicht. Ist Akkon eine uneinnehmbare Festung? Für uns nicht.«
Er ließ die Worte einwirken.
»Seit dem sechsten April stürmen unsere Truppen pausenlos die Festung, ohne sie einnehmen zu können. Aber die Angriffe haben die Verteidiger zermürbt, ihre Verteidigungswälle geschwächt. Einige Türme des äußeren Walls sind eingestürzt. Vor drei Tagen hatten unsere Männer den Feind am Sankt Antoniustor bereits hinter den inneren Ring zurückgedrängt. Der Anführer der Hospitalritter blies zum Gegenangriff, sie vertrieben unsere Krieger. Beim nächsten Angriff wird ihnen das nicht mehr gelingen. Denn heute, noch vor Sonnenuntergang, wird Akkon wieder in muslimischer Hand sein.«
Seine Augen blitzten. »Hört meinen Plan: Unsere Armeen werden gleichzeitig zuschlagen. Im Norden, wo die Tempelritter kämpfen, haben unsere syrischen Verbündeten aus Hama den äußeren Wall bereits zerstört. Am Lazarustor werden sie den inneren Befestigungsring der Stadt durchbrechen und durch Montmusard von der Innenseite zum Sankt Antoniustor vorpreschen. Wir, die ägyptischen Armeen, greifen im Osten das Sankt Antoniustor an. Es ist bereits stark geschwächt, wir werden es sprengen und dringen von dort in die Stadt. So nehmen wir den Feind in die Zange.«
Die Offiziere schwiegen. Der Plan war gut.
Chalil wandte sich zwei der Männer zu. »Ahmad und Said, ruft alle Offiziere zusammen im roten Zelt, ich werde gleich zu ihnen sprechen.« Er entließ sie mit einer kurzen Handbewegung.
Er richtete den Blick auf den dritten Offizier.
Zu jung für den Rang eines obersten Offiziers. Dazu auch noch stumm. Das hat er durch Mut und Rücksichtslosigkeit mehr als wettgemacht. Die Soldaten respektieren ihn, folgen ihm blind.
Der Offizier stand regungslos da, die Augen auf den Boden gerichtet.
Chalil kannte sein Geheimnis und hielt die Zeit für gekommen, ihm diese Kenntnis zu offenbaren.
»Omar ibn Hassan al-Raschid, für dich habe ich eine besondere Aufgabe.«
Der Krieger hob den Kopf. In seinen Augen sah Chalil den bedingungslosen Gefolgschaftswillen und die Bereitschaft, unter Einsatz seines Lebens für seinen Sultan zu kämpfen. »Ich weiß, wer du bist und wo du herkommst.«
Der Angesprochene hob die Brauen.
»Kennst du den Namen Hassan-i Sabbah, des Feldherrn, der ›Schêch el-Dschibâl‹ genannt wurde?«
Omars Blick verriet ihm, dass er den Namen noch nie gehört hatte.
»Der Herr der Berge war ein Führer der Ismailiten in Persien, der Herrscher der Burg Alamut. Er gründete einen Orden, der sich rasch ausbreitete: den Orden der Hasschischiyyin.«
Beim letzten Wort verengten sich die Augen des Kriegers.
Chalil ließ sich nichts anmerken und fuhr fort: »Doch er war nicht der berühmteste Assassine. Das war Raschid al-Dîn, den die Kreuzfahrer verächtlich den ›Alten vom Berge‹ nannten.«
Beim Hören des gefürchteten Namens leuchteten die Augen des Kriegers auf. Chalil genoss den Augenblick, da sein Gegenüber ahnte, wohin der Vortrag führte. Dann sagte er es ihm: »Du bist sein Nachkomme.«
Der Körper des Jünglings spannte sich wie eine Raubkatze.
Chalil sprach weiter, als hätte er Omars innere Aufregung nicht bemerkt.
»Die Organisation der Assassinen wurde zur Bedrohung für Sultan Baibars, der sie verbot. Doch sie existiert weiter im Verborgenen, nicht wahr?«
Der junge Mann öffnete den Mund, als wollte er antworten, doch Chalil hob die Hand. »Keine Sorge Omar, ich respektiere diesen Orden und seine Ziele.«
Omars Körper entspannte sich, doch die Augen blieben auf Chalil gerichtet.
»Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Höre zu, was ich dir zu sagen habe.«
Chalil schaute ihm nach, während der junge Krieger in Richtung des großen Zeltes verschwand. Nachdem er vor einiger Zeit herausgefunden hatte, dass sein jüngster Offizier zum verbotenen Orden der Assassinen gehörte, hatte er ihn in seinen engsten Kreis aufgenommen und gefördert. Mit einer klaren Absicht: Mit seinen Fähigkeiten könnte er von unschätzbarem Wert sein, um Chalils Position gegen fremde Machtansprüche zu sichern.
Er dachte an den Anlass für die Mission, die er ihm mit auf den Weg gegeben hatte. In letzter Zeit geschahen merkwürdige Dinge: Im März dieses Jahres, kurz vor dem Aufbruch seiner Armee aus Kairo, war ein hoher Gesandte der großen Kirche aus Rom mit einem Ersuchen an ihn herangetreten. Er wusste von der bevorstehenden Belagerung der Hafenstadt Akkon. Ebenso sei die Kirche sich gewiss darüber, dass Sultan Chalil die Stadt einnehmen würde. Dem Gesandten ging es um geheimnisvolle Schriften im Hause der teutonischen Ritter, die um jeden Preis sichergestellt werden mussten. Gegen Aushändigung dieser Schriften versprach der Gesandte ihm eine Menge Silber. Er hatte sich gewundert, was an ihnen so wichtig wäre, dass die Kirche so viel für ihren Besitz zahlen wollte, sogar einem Feind? Doch er zerbrach sich den Kopf nicht darüber, er benötigte Silber, viel Silber, um seine Armee zu bezahlen. Gleichgültig, wo es herkam. Er würde die Stadt einnehmen, die Schriften finden und sie dem Gegner verkaufen.
Er warf einen letzten verheißungsvollen Blick auf die Stadt.
»Für dich, Vater, und den Islam werde ich diese Barbaren endgültig zerstören. Inschallah.«

Im Dihliz, dem roten Zelt des Hauptquartiers, redeten die Offiziere aufgeregt durcheinander. Als das herunterhängende Tuch im Eingang zur Seite geschoben wurde, verstummten sie, drehten die Köpfe. Chalil trat herein und bestieg das Podest, das am Kopf des Zeltes aufgebaut war.
Alle Blicke richteten sich auf ihn, den jungen Sultan, der das Heer von seinem Vater, der vor einem halben Jahr verstorben war, übernommen hatte.
Chalil sah Zweifel in vielen der Blicke.
Einige von ihnen wissen,dass mein Vater meinen älteren Bruder Ass Salih-Ali mir vorgezogen hat.
Doch Salih-Ali starb vor drei Jahren. Dann gab es nur noch ihn, Al-Ashraf Chalil, als Nachfolger des Sultans des ägyptischen Stammes der Mamluken. Nach dem Tod seines Vaters war das Misstrauen gegen ihn geblieben. Er würde es beseitigen, den endgültigen Respekt seiner Soldaten gewinnen, um als Heeresführer in den kommenden Kriegen Unsterblichkeit zu erlangen.
Dazu muss ich Akkon erobern!
Er sah in die Gesichter der vier Offiziere, die direkt vor ihm standen. Sie waren die Anführer der syrischen Armeen, die Wichtigsten, die es zu überzeugen galt: Hossam ad-Dîn Lajin aus Damaskus, al-Muzaffar Taqai ad-Dîn aus Hama, Saif ad-Dîn Bilban aus Tripolis und Baibars al-Dewadar aus Al Karak.
Meine Rede wird den Anfang machen.
Er ließ den Blick über die Männer im Zelt gleiten.
»Offiziere des Heeres der Mamluken, der siegreichsten Armee der islamischen Welt! Seit zweiundvierzig Tagen kämpft ihr und habt die feindlichen Bastionen schwer geschwächt. Eure Krieger sind tapfer, unseres Stammes würdig. Die Zeit ist jetzt gekommen für den entscheidenden Angriff! Doch zuerst sage ich euch, weshalb wir siegen müssen und siegen werden.«
Sein Blick wanderte über die Köpfe der Offiziere zu beiden Seiten des Zeltes und verharrte dann auf den vier Heerführern vor ihm.
»Von alther ist Akkon eine muslimische Stadt. Die Menschen lebten in Eintracht und Frieden, bis die Kreuzfahrer kamen. Zuerst versuchte König Balduin von Jerusalem vergeblich, die Stadt zu erobern. Dann unternahm er einen zweiten Versuch, diesmal mithilfe der genuesischen Flotte. Eine große Übermacht! Der Statthalter El-Dschuhuyschi wollte kein weiteres Blutvergießen. Er übergab die Stadt unter der Bedingung, dass alle Bewohner mitsamt ihrem Hab und Gut freies Geleit erhielten.«
Chalil unterdrückte den Zorn, als er daran dachte, was danach geschah.
Ich darf keine Emotionen zeigen. Noch nicht.
»Als sie die Kostbarkeiten sahen, welche die Bewohner beim Verlassen der Stadt mit sich schleppten, fingen die Christenhunde an zu plündern. Zu morden. Tausende Muslime wurden erbarmungslos abgeschlachtet, Männer, Frauen und Kinder.«
Er schwieg einen Augenblick, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen.
»Erst viel später war es Sultan Saladin, der in der Schlacht bei Hattin den Kreuzfahrern eine verheerende Niederlage zufügte und Akkon zurückeroberte.«
Die Männer hörten ihm jetzt gebannt zu. Alle kannten die Legenden um den berüchtigten Saladin.
»Erneut versuchten die Christen, Akkon zurück zu erobern. Der Überraschungsangriff Ihres Königs Guido, gleichzeitig zu Land und vom Meer, wurde zurückgeschlagen. Danach wartete der Feigling auf Verstärkung. Er wartete vier Jahre lang, während unsere muslimischen Brüder die Angriffe der Kreuzfahrer immer wieder abwehrten und Sultan Saladin die Belagerer attackierte. Dann kam Richard Löwenherz.«
Beim Hören dieses Namens fuhr ein Raunen durch die Reihen der Männer. Jeder hatte von den Heldentaten des gefürchteten Königs der Engländer gehört.
»Nachdem es Saladin nicht gelang, die Belagerungslinien zu durchbrechen, kapitulierten unsere Brüder schließlich. Sie wurden gefangen genommen, ein Austausch wurde vereinbart.«
Er erhob die Stimme. »Löwenherz brach die Vereinbarung und ließ die Gefangenen umbringen. Wieder starben Tausende Muslime!«
Jetzt tobten die Männer, wutentbrannt streckten sie ihre Schwerter in die Luft.
Chalil hob die Hand, sofort kehrte Ruhe ein.
»Doch das war noch nicht das Ende der Gräueltaten der Kreuzfahrer! Der Frieden hielt nicht lange. Die Kreuzfahrer eroberten immer mehr Gebiete, vertrieben unsere Brüder. Doch wir schlugen zurück. Sultan Baibars eroberte die letzte große Festung der teutonischen Ritter, die Burg Montfort – und gewährte ihnen freien Abzug. Ein großer Fehler: Man darf Kreuzfahrer nicht am Leben lassen!«
Die vier Heeresführer vor ihm nickten.
Chalil fuhr fort: »Im August letzten Jahres haben Kreuzfahrer in Akkon ein Blutbad unter unseren muslimischen Brüdern und Schwestern angerichtet. Mein Vater Sultan Qalawun verlangte die Auslieferung der Täter, dazu eine Entschädigung von dreißigtausend venezianischen Zecchinen.«
Vater hatte nicht damit gerechnet, dass seine Forderungen erfüllt werden. Er benötigte einen Anlass, die Stadt anzugreifen.
»Die Stadträte haben seine Forderungen schroff abgelehnt und die Täter ziehen lassen. Daraufhin entschied mein Vater, die Stadt anzugreifen.«
Er sah ein letztes Mal in die Runde der Männer.
Dann schrie er: »Die verdammten Christen für alle Ewigkeit zu vertreiben, das war der Schwur meines Vaters, des Sultans al-Mansur Saif ad-Din Qalawun al-Alfi!«
Er streckte beide Hände in die Luft. »Auch ich, sein Sohn Sultan Al-Malik al-Ashraf Salah ad-Dîn Chalil, habe am Sterbebett meines Vaters geschworen, das Land endgültig von den Kreuzfahrern zu befreien!«
Er zog sein Krummschwert, richtete es auf die Umrisse der Festung, die durch die Öffnung des Zeltes hindurch in der Ferne sichtbar wurden.
»Wir werden Akkons Mauern zum Einsturz bringen und das verfluchte Königreich Jerusalem zum Islam zurückführen. Heute werden wir siegen! Rächt die Ermordeten, kämpft für den Islam, kämpft für Allah! Es wird keine Überlebenden geben, tötet sie alle! Allahu Akbar!«
Die Männer tobten, schrien seine Worte nach. »Tod den Kreuzfahrern, Allahu Akbar!!«
Und es geschah. Zuerst zögernd: »Al-Ashraf!, Al-Ashraf!« Dann lauter, bis alle brüllten: »AL-ASHRAF!, AL-ASHRAF!«
Ich habe es geschafft. Die Offiziere, meine Offiziere, stehen jetzt hinter mir. Sie werden für mich kämpfen, für mich sterben!
Die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne schossen wie Pfeile durch die Nebelschwaden, trafen die Festungsmauern der Kreuzritterbastion.
Färbten sie blutrot.
Der letzte Angriff auf Akkon begann
.

Der Wächter auf dem Turris Maledicta, dem Turm der Verdammnis, spähte in die Finsternis, auf der Suche nach einer Bewegung des feindlichen Heeres. Die ganze Nacht hatte sich nichts gerührt. Eine Unheil verkündende Stille hing über der Stadt.
Als erster Bote des Morgens erschien ein hauchdünnes dunkelrotes Band über den Kämmen der Berge Galiläas im Osten. Es wurde zunehmend breiter und heller. Langsam vertrieb es die Dunkelheit aus der Ebene von Akkon.
Während der Schatten der Nacht zurückwich, kroch ein zweites rotes Band hervor. Es dehnte sich allmählich über die gesamte Ebene aus. Bewegte sich, seitwärts windend wie eine angreifende Sandviper, dunkelrot drohend auf die Festung zu.
Dann hörte der Wächter es. Zuerst das dumpfe, rhythmische Schlagen der Trommeln und Pauken, dann das Getön der Blashörner und Zimbeln der Männer auf den Kamelen, das wenig später zu einer ohrenbetäubenden Kakophonie anwachsen würde.
Die übermächtige Armee der Mamluken setzte zum letzten, tödlichen Angriff an.
Der Wächter griff nach seinem Horn und blies das Alarmsignal.
Wenig später läuteten die Kirchglocken über der dem Tode geweihten Stadt.

Auf dem südlichen Wehrturm des inneren Verteidigungswalls, dem Turm der Teutonen, suchte Wilhelm den westlichen Horizont ab. Sein Bruder Heinrich hatte ihn auf den Turm beordert, um Ausschau nach der venezianischen Flotte zu halten, die der Deutschmeister Konrad von Feuchtwangen versprochen hatte, um die Frauen und Kinder in Sicherheit zu bringen.
Vor Beginn der Belagerung hatten die Johanniter und Templer die eigenen Angehörigen auf ihren letzten Galeeren in Sicherheit gebracht. Da die Schiffe überfüllt waren, hatten die Männer beschlossen, zurückzubleiben. Sie wollten Akkon bis in den Tod verteidigen.
Der Deutsche Orden besaß im Gegensatz zu den anderen Orden keine eigenen Schiffe. Ihre Ordensschwester und die Frauen und Kinder deutscher Kreuzfahrer harrten in der deutschen Bastion. Sie bangten und hofften, eingeschifft zu werden, bevor die Horden der Mamluken die Stadt eingenommen hätten.
Wilhelms Gedanken wanderten zurück zum Vorabend, als der oberste Befehlshaber von Akkon, Amalrich von Tyrus, der Bruder des Königs Heinrich II, eine letzte Lagebesprechung gehalten hatte. Mit dem Großmeister der Templer Guillaume de Beaujeu, dem Großmeister der Johanniter Jean de Villiers, dem Statthalter und Marschall des Deutschen Ordens Heinrich von Bolanden und den Marschallen der weiteren, kleineren Orden hatte er die Strategie der Verteidigung besprochen. An der schwer beschädigten Nordwestmauer stellten sich die Templer und die wenigen Ritter des Lazarusordens den syrischen Armeen. Die Nordostmauer als möglichen Hauptangriffspunkt verteidigten die Johanniter, neben ihnen an der Ostflanke bis zum Antoniustor Amalrichs eigene Truppen. Die Deutschordensritter sollten die Mauer vom Antoniustor bis zum Turm der Verdammnis verteidigen. Die Franzosen unter Jean de Grailly und die Engländer unter Otton de Grandson waren für die Ostmauer, die bis ins Meer verlief, zuständig.
Für den Fall, dass der äußere Verteidigungsring fiel und es nicht gelänge, die einfallenden Truppen zurückzuschlagen, würde das Hornsignal zum Rückzug geblasen. Darauf mussten sich alle Kämpfenden hinter den inneren Verteidigungsring zurückziehen.
Wilhelm sah hinunter zum Hafen. Bis dorthin waren die Gegner noch nicht vorgedrungen. Dazu mussten sie erst die deutsche Bastion als letztes Hindernis überwinden. Danach mussten die Deutschordensritter den Hafen halten, bis die Frauen und Kinder eingeschifft waren und die Schiffe abgelegt hatten.
Schiffe, die nicht mal am Horizont zu sehen sind, während die Schlacht um Akkon tobt!
Im Südwesten ragten die Türme der Eisenburg, des Hauptquartiers der Templer, aus dem Morgennebel empor.
Wenn es dem Feind gelingt, die Burg einzunehmen, ist Akkon endgültig verloren.
Aus der Richtung des Kastellums im Norden näherte sich Kampflärm, das Klingen von Stahl auf Stahl, das Gebrüll der Kämpfenden, gemischt mit den Todesschreien der Sterbenden. Rauchwolken stiegen aus den Häuserschluchten auf.
Das Geschrei erinnerte Wilhelm an die Ereignisse im Spätsommer des vorigen Jahres, als das Massaker an den Muslimen seinen blutigen Lauf nahm.
Und an das, was vorher geschah.
Alles begann mit der Ankunft des Inquisitors Kardinal da Lucca . Er hatte es auf die Bruderschaft abgesehen, die sich nahe der Bastion des Deutschen Ordens und unter dessen Schutz aufhielt. Er hatte sie der Häresie bezichtigt und vom Deutschen Orden verlangt, ihr den Prozess zu machen. Außerdem forderte er die Herausgabe ihrer Schriften. Sein Bruder Heinrich weigerte sich, den Prozess durchzuführen, der Kardinal reiste nach wenigen Tagen ab. Sein glühender Blick beim Abschied verhieß nichts Gutes.
Wenige Tage später erschien Manfred von Gerbrand im Deutschen Haus und gab Wilhelm einen ledernen Köcher mit Papyrusrollen. Die geheimen Schriften mussten um jeden Preis erhalten bleiben.
Als hätte sein Freund es geahnt, zogen wenig später die Genuesen mordend durch die Stadt.
»Wilhelm!« Der Ruf riss ihn aus seinen Gedanken.
Sein Bruder Heinrich kam die Stufen heraufgestürmt.
»Wir können unsere Stellungen nicht mehr lange halten.«
Außer Atem stützte Heinrich von Bolanden sich auf die Umwehrung und sah zum Meer. »Hast du etwas gesehen?«
»Nein, nichts. Wie sieht es bei den anderen Orden aus?«
»Schlecht. Die erste Angriffswelle konnten die Johanniter noch abwehren. Dann gab es diese schweren Explosionen. Der Feind hat in der Nacht das Sankt Antoniustor unterminiert, dort mit Schwarzpulver gefüllte Gefäße deponiert und sie mit in griechischem Feuer getunkten Pfeilen angezündet. Der Eckpfeiler des linken Torflügels stürzte ein und mit ihm ein Teil der Mauer. Der zweite Verteidigungsring ist zusammengebrochen.«
»Dann ist der Zugang zur Stadt jetzt frei?«
»Leider ja. Sie dringen in die Stadt vor, schreien ›Allahu Akbar!‹ Die Johanniter verteidigen sich mit dem Mut der Verzweiflung. Jean de Villiers ist schwer verletzt, sie bringen ihn mit König Heinrich und seinem Bruder Amalrich auf das letzte Schiff in Sicherheit. Heinrichs Soldaten sind geblieben,«
»Wer hat bei den Johannitern jetzt das Kommando?«
«Mathieu de Clairmont.«
»Und die Templer?«
»Im Nordwesten haben die Syrer zur gleichen Zeit das Sankt Lazarustor durchbrochen. Guillaume de Beaujeu ist gefallen, die Templer werden jetzt von ihrem Marschall Pierre de Sevry angeführt. Ich habe gehört, dass sie anfänglich heftigen Widerstand leisteten, sich dann zurückzogen und den Johannitern am Antoniustor zur Hilfe geeilt sind. Jetzt kämpfen sie gemeinsam gegen die von zwei Seiten heranstürmenden Mamluken. Die letzte Nachricht ist, dass sie sich zum Häuserkampf zurückgezogen haben. Mann gegen Mann. Und sie bewegen sich in Richtung Hafen.«
»Wie viele Kämpfer haben wir noch?«
»Ich habe nahezu fünfzig Ritterbrüder zum Nikolaustor an die Ostmauer verlegt. Dort wird heftig gekämpft, wir mussten den Franzosen und Engländern helfen, das Tor zu halten. Wenn die Mamluken dort durchbrechen, sind sie im nu in der deutschen Bastion und im Hafen.«
»Was sollen wir tun?«
»Ich habe die Frauen angewiesen, das Deutsche Haus und die Nikolauskirche zu räumen und mit den Kindern zum Strand am Hafen zu gehen. Einige bewaffnete Ordensbrüder werden sie begleiten. Wir versuchen, den Feind aufzuhalten, bis sie die Bastion verlassen haben. Im Hafen sollen sie in die Ruderboote einsteigen, aber nicht mehr als zwei Brüder zum Rudern in jedem Boot. Sie sollen auf das Meer hinausfahren und versuchen, an der Küste entlang nach Tyros zu gelangen. Es ist der einzige Fluchtweg. Bei vorherrschendem Südwind können sie die Strecke in wenigen Tagen schaffen.«
»Was soll ich tun?«, fragte Wilhelm, seinen Blick stets in die Ferne gerichtet.
»Wir wissen beide, was du zu tun hast, Bruder.«
Anstatt zu antworten, zeigte Wilhelm in die Ferne.
»Segel am Horizont!«
Heinrich kniff die Augen zusammen, schaute in die Richtung, in die Wilhelm zeigte. Seine Augen waren nicht mehr so scharf wie die seines jüngeren Bruders.
»Wo siehst du Segel?«
Wilhelm zeigte auf einen Punkt am westlichen Horizont. Jetzt sah auch Heinrich sie, die Anzahl war für ihn nicht zu erkennen. Doch sein Bruder kam ihm wieder zuvor.
»Vier Schiffe!«
Die Flotte aus Venedig. Nur vier Schiffe?
Ohne seine Augen von den weißen Punkten am Horizont abzuwenden, gab Heinrich seinem Bruder neue Anweisungen:
»Befehle den Leuten, in die Boote zu steigen, aber im Hafen zu warten, bis die Galeeren angelegt haben. Sie sollen von der Wasserseite einsteigen. Alle, die keinen Platz in den Ruderbooten bekommen, sollen zu den Landestegen. Ich werde die Männer zur Verteidigung des Hafens zurückziehen. Unser oberstes Ziel ist jetzt die Rettung der Frauen und Kinder.« Er sah Wilhelm an. »Danach gehst du ins Deutsche Haus, holst den Köcher mit den Schriften deines Freundes Manfred von Gerbrand und steckst das restliche Geld aus der Schatztruhe ein. Auf dem Tisch liegt mein Brief an den Grafen Adolf von Nassau, worin ich geschrieben habe, was hier passiert ist und welche Rolle die Inquisition dabei gespielt hat. Sieh zu, dass er den Grafen erreicht, die Gräueltaten müssen gesühnt werden. Dann nimmst du den unterirdischen Gang zum Hafen und gehst an Bord der ersten Galeere, die anlegt.«
»Nein, Heinrich, ich bleibe hier und werde kämpfen!«
Sein Bruder schüttelte den Kopf.
»Nein, Wilhelm, du hast das Schwert abgelegt, bist jetzt ein Graumäntler.«
»Du hast mir selbst gesagt, dass ich jederzeit das Grau gegen das Weiß tauschen kann. Ich werde das jetzt tun.«
»Das wirst du nicht tun!«
»Warum nicht?«
»Ich war dabei, als Manfred dir den Köcher gab, ich weiß von den geheimen Schriften. Du hast ihm versprochen, sie in Sicherheit zu bringen.«
Doch Wilhelm bewegte sich nicht. »Manfred ist tot. Ich werde wegen ein paar Schriftrollen dich und die anderen nicht im Stich lassen. Jeder Mann, der kämpfen kann, ist jetzt wichtig. Du kannst nicht von mir verlangen, dass ich mich feige auf ein Schiff rette.«
Heinrich drehte sich langsam zu seinem jüngeren Bruder.
»Willst du zum zweiten Mal ein großes Versprechen brechen?«
Wilhelm wich zurück, die Augen aufgerissen. »Wo ... wovon sprichst du?«
»Von Maria.«
Maria! Bilder der Vergangenheit. Der Ritterschlag. Der weiße Umhang mit schwarzem Kreuz, das geweihte Schwert ...
Sein Bruder fuhr fort: »Ich kenne dein Geheimnis, weiß von deiner Schuld, weshalb du in Sizilien den weißen Mantel und das Schwert abgelegt und gegen die graue Kutte getauscht hast. Seit deinem Rittergelübde bist du nicht mehr der gleiche Mensch, nicht mehr mein fröhlicher kleiner Bruder. Wie lange trägst du sie mit dir, diese Schuld? Wie euer Kind, das nie geboren wurde, so wird sie nie aus dir herausbrechen. Du wirst mit ihr sterben. Nicht den Heldentod, sondern einen Tod in Schuld.« Heinrich stockte, dann fuhr er fort: »Sterben werden wir jetzt alle. Doch du, du hast nicht nur die Möglichkeit, zu überleben, sondern, was viel wichtiger ist, dein Versprechen zu erfüllen, die Schriftrollen nach Coblenz zu bringen und Manfreds Arbeit fortzusetzen. Nur du kannst das.«
Er legte die Hände auf Wilhelms Schulter. »Ich gebe dir nicht den Befehl, sondern die Freiheit, es zu tun.«
Wilhelm antwortete nicht, starrte seinen Bruder an, Tränen in den Augen.
»Geh jetzt, kleiner Bruder«, sagte Heinrich leise.
Wilhelm drehte sich um und rannte die Stufen hinunter.
Heinrich von Bolanden sah ein letztes Mal zum Meer. Die Schiffe waren jetzt deutlich zu erkennen.
»Beeile dich, Konrad«, flüsterte er. Dann drehte er sich um, verließ die Plattform und machte sich auf den Weg zu seinen Männern.

Drei in Schwarz gekleidete Gestalten beobachteten das Haus der teutonischen Ritter. Soeben hatte ein Ordensbruder im grauen Umhang das Gebäude betreten. Er schien allein zu sein.
Der Anführer gab seinen Kriegern ein Zeichen.
Wie Schatten schlichen sie auf das Haus zu.

Im Deutschen Haus herrschte Todesstille. Wilhelm ging die Stiege hinauf, nahm den Köcher mit den beiden Schriften und betrat die Kammer seines Bruders. Er faltete den Brief an Herzog Adolf und steckte ihn in einen Lederbeutel. Aus der fast leeren Schatztruhe füllte er diesen und einen zweiten mit den letzten Silbermünzen.
Er knüpfte beide mit einem Strick aneinander, hängte sie um den Hals und schob sie unter seine Tunika. Diese schnürte er mit dem Gürtel fest, damit die Beutel ihn bei einer Flucht nicht behinderten. Den Köcher befestigte er an einem Trageriemen und hängte ihn um. Dann verließ er die Kammer.
Unten an der Stiege hielt er inne.
Ein Geräusch draußen vor der Tür!
Die Türklinke wurde hinuntergedrückt.
Er schlich in die Küche, drehte sich in der Tür um, schaute in die Eingangshalle.
Maskierte Männer in schwarzen Gewändern! Was wollen die hier?
Einer sah zu ihm herüber, rannte auf ihn zu.
Er schlug die Tür zu, schob den Riegel vor, eilte durch die Küche in die Speisekammer. Tritte gegen die Tür. Durch eine im Boden eingelassene Luke kletterte er eine Leiter hinunter, zog die Klappe über sich zu und hastete durch den Tunnel.

Deutschmeister Konrad von Feuchtwangen stand auf dem Vordeck der Galeere und betrachtete die Festung.
Rauch hing über der Stadt.
Kein gutes Zeichen.
Gegen den Rat des Dogen von Venedig war er mit vier Handelsgaleeren und einer eilig zusammengerufenen Gruppe Ritterbrüder in See gestochen, um in Akkon zu retten, was zu retten war. Ihm war zu Ohren gekommen, dass der Hochmeister Burchard von Schwanden aus dem Orden ausgetreten und sich den Johannitern angeschlossen hatte. Das wunderte ihn: Von Schwanden hatte sich doch immer um die Bastion Akkon, den Hauptsitz des Deutschen Ordens gekümmert! In der Ballei Sizilien hatte er sogar für die Verteidigung der Stadt geworben. Nicht sehr erfolgreich, nur vierzig Ritterbrüder waren ihm gefolgt, darunter sogar der Hauptkomtur Heinrich von Bolanden, den er dann als seinen Statthalter in Akkon ernannt hatte.
War wohl auch der Grund gewesen, dass der mitgekommen war.
Nicht dass er von Schwandens Schritt bedauerte, keineswegs. Er, Konrad, hatte Palästina schon lange aufgegeben, die Übermacht der Muslime war zu groß! Er sah die Zukunft des Deutschen Ordens eher im preußischen Marienburg.
Doch der Zeitpunkt der Aufgabe des Hochmeisteramtes zeugte von Feigheit, jetzt, da die Feindseligkeiten im Heiligen Land ihren Höhepunkt erreichten.
Konrad sah sich gezwungen, Hilfe zu leisten, um möglichst viele Brüder, Frauen und Kinder zu retten.
Die Galeeren näherten sich dem Hafen. Die Strahlen der untergehenden Sonne tauchten die beiden Wehrtürme links und rechts der Hafeneinfahrt in ein goldenes Licht.
Mit Schrecken fiel ihm die Sperrkette ein, die unsichtbar für feindliche Schiffe zwischen dem Turm am Hafen und dem Wehrturm gespannt war, der am Ende des weit ins Meer hineinragenden Festungswalls stand. Im Fall eines Angriffs vom Meer aus konnte die Kette hochgezogen werden, hatte man ihn erzählt.
Hoffentlich ist sie unten!
Ihnen rannte die Zeit davon. Konrad wandte sich an den Kapitän. »Wir müssen schneller in den Hafen fahren!«
»Schneller geht nicht«, antwortete der Seemann. »Wir lassen jetzt die Segel herunter und rudern die restliche Strecke bis zum Anlegesteg.«
Rudern?
»Warum nicht die Segel oben lassen? Sind wir dann nicht schneller?«
Der Kapitän schnaubte, ersparte sich aber eine bissige Antwort. Dieser Mann war nicht irgendjemand, sondern ein Freund des Dogen von Venedig!
»Mit einem kleinen Boot wären wir unter Segel sicher schneller«, antwortete er, »aber nicht mit einer Galeere. Außerdem wäre das zu gefährlich. Es braucht nur eine kurze Windböe und das Schiff würde den Landesteg zerschmettern.«
Er gab den Befehl, die Segel zu streichen. Die Ruderer fuhren die Riemen aus. Ein Ruck durchfuhr das Schiff, als die Galeere beschleunigte.
Ungehindert ruderten sie zwischen den beiden Wehrtürmen hindurch.
Barken trieben im Hafen. Die Insassen schrien, winkten mit den Armen. Konrad sah wenige Ordensbrüder, aber viele Frauen und Kinder. Die vorderste Galeere drosselte durch Gegenrudern die Geschwindigkeit, um sie an Bord zu nehmen.
Je näher sie den Landestegen kamen, umso lauter wurde das Geschrei.
Der Kampf ist in vollem Gange, wir kommen zu spät!
Auf dem Kai brach Tumult aus. Menschen rannten schreiend zu den Anlegestegen. Kreuzritter verschiedener Orden stürmten aus den Gassen, die auf die Hafenkante mündeten. Sie formierten sich, kämpften gegen die nachrückenden feindlichen Truppen, versuchten die Angreifer zurückzudrängen. Die Umhänge der Ritter glänzten blutverschmiert. Konrad hatte Mühe, die weißen Mäntel der Deutschordensritter von den roten Kampfgewänder der Johanniter zu unterscheiden.
Die Galeeren erreichten die Landestege. Die Riemen auf der Seite der Stege wurden hochgezogen, Trosse flogen hinüber, Hände fingen sie auf, schlugen sie um Pfähle, Bootsplanken wurden auf die Stege geschoben.
Die mitgereisten Ritterbrüder rannten mit gezogenen Schwertern von den Galeeren herunter, bahnten sich einen Weg durch die heranstürmende Menschenmenge und stürzten sich in die Schlacht. Sobald sie die Galeeren verlassen hatten, drängten die Frauen und Kinder an Bord.
Meine Ritter können nicht mehr entscheidend in die Schlacht eingreifen. Alle werden sterben!
Mit einer Handvoll an Bord zurückgebliebener Brüder versuchte er, die auf das Schiff stürmenden Menschen zu ordnen.
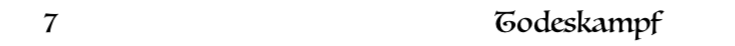
In der Straßenmündung zum Hafen kämpfte Heinrich von Bolanden mit seinen Männern verzweifelt gegen die Übermacht der Muslime. Das Schild hatte er weggeworfen, um sein Schwert beidhändig zu schwingen. Neben den Deutschrittern kämpften die Johanniter. Ihr Marschall Mathieu de Clairmont stand in der vordersten Reihe. Noch hielten beide Gruppen den Angriffen der Mamluken stand. In den engen Gassen konnten die Gegner sich nicht formieren. Im Kampf Mann gegen Mann waren die Kreuzritter mit ihren längeren Schwertern im Vorteil. Doch mit der Zeit wurden sie immer weiter zurückgedrängt.
Heinrich warf einen Blick zurück. Im Hafen hatte die erste Galeere am Landesteg angelegt. Bewaffnete Ordensritter eilten den Verteidigern zu Hilfe.
Zu wenige! Aber sie sorgen für Entlastung, damit die Frauen und Kinder Zeit haben, an Bord zu gehen.
»Heinrich!« Er wirbelte herum. Am Ende des Kais stürzte sein Bruder aus der Tür in der Stadtmauer, wo der Versorgungstunnel endete.
»Wilhelm!« Er löste sich aus dem Kampfgewühl und rannte ihm entgegen.
»Ich werde verfolgt ...«
In diesem Augenblick drangen drei maskierte Männer in schwarzen Kampfgewändern durch dieselbe Tür, durch die Wilhelm soeben auf den Kai gelangt war. Mit gehobenen Krummschwertern rannten sie auf ihn zu. Ihr Schweigen kam Heinrich beängstigender vor als das Geschrei der Kämpfenden.
Sein Bruder sah sich um, rannte auf einen gefallenen Ritter zu, wollte das auf dem Boden liegende Schwert aufheben.
»Nein, Wilhelm, auf zu den Galeeren! Bring dich in Sicherheit!«, schrie Heinrich ihm zu und stürzte sich an seinem Bruder vorbei auf die Angreifer.
Den vordersten Krieger traf er mit voller Wucht, doch sein Schwung ließ ihn einen Moment lang ungeschützt. Der nächste Kämpfer holte aus. Im letzten Moment parierte er den Schlag. Mit dem nächsten Schwerthieb streckte er den Gegner nieder.
Der Dritte warf sich mit erhobenem Schwert auf Wilhelm. Der wich zurück, stolperte über den gefallenen Ritter, stürzte rücklings auf den Boden.
Sein Gegner stellte sich breitbeinig vor ihn hin, die schmalen Lippen zu einem kalten Grinsen verzogen. Mit einer schnellen Bewegung schnitt er mit der Schwertspitze den Riemen des Köchers durch und hob ihn auf. Dann holte er aus zum tödlichen Hieb.
Im letzten Moment zog Wilhelm die Beine an, stieß sie seinem Gegner hoch zwischen die Oberschenkel. Der Mann gab keinen Laut von sich, ließ den Köcher fallen, taumelte zurück. Heinrich fuhr dazwischen, mit heftigen Schwerthieben trieb er den Angreifer von seinem Bruder weg.
Nach Luft ringend hob Wilhelm den Köcher auf und sah um sich. Zwei der Angreifer lagen tot auf dem Pflaster. Wo war der dritte, der Maskierte der ihn angegriffen hatte?
Wo ist Heinrich?
Er entdeckte seinen Bruder, der den Gegner mit mächtigen Schlägen an den Rand der Hafenmauer trieb. Der Maskierte machte einen Täuschungsschritt rückwärts. Ein Aufblitzen, Heinrich ließ das Schwert fallen. Triumphierend zog der Maskierte seinen Dolch aus Heinrichs Körper und hob das Krummschwert für den Hieb durch den Hals des Gegners. Ein teuflisches Grinsen umspielte seine Lippen.
Wilhelm schrie. Als das Krummschwert heran sauste, warf sein Bruder sich mit dem Kopf voran gegen den Krieger. Das Krummschwert streifte Heinrichs Rücken, sein Gegner verlor das Gleichgewicht, trat einen weiteren Schritt zurück. Das Grinsen erstarrte, als er mit den Armen rudernd rückwärts von der Kaimauer taumelte.
Wilhelm beugte sich über seinen Bruder, sah die klaffende Wunde in dessen Brust. »Heinrich, du bist verletzt!«
Sein Bruder richtete sich auf.
»Kümmere dich nicht um mich. Ich werde bald sterben. Geh jetzt auf ein Schiff, schnell!«
Wilhelm rührte sich nicht.
»Was waren das für Krieger?«
»Ismailitische Meuchelmörder vom verbotenen Orden der Assassinen. Sie hatten es auf dich abgesehen.«
»Nicht auf mich. Auf den Köcher.«
Heinrich stöhnte, sah hinüber zu den Galeeren. Zu viele Menschen standen noch auf dem Landesteg.
»Geh zu den Schiffen, die Leute sollen sich bewegen, schnell! Ich werde meine Männer auf dem Kai zusammenziehen, um euch die nötige Zeit zu geben.«
Wilhelm bewegte sich immer noch nicht. »Heinrich, du bist schwer verletzt, du kannst nicht mehr kämpfen, ich bringe dich auf die Galeere.«
Sein Bruder winkte ab. »Solange ich mein Schwert halten kann, werde ich kämpfen.« Er legte die Hand auf Wilhelms Schulter. »Kleiner Bruder, dein Kampf ist hier zu Ende. Ein neuer und schwererer Kampf beginnt für dich. Du musst dein Versprechen einlösen, hast eine Aufgabe, die wichtiger ist, als hier zu sterben. Nun geh!« Er umarmte Wilhelm.
Dann warf er einen letzten Blick auf den Maskierten im Wasser, drehte sich um und eilte zurück in den Kampf.
Wilhelm rannte zur letzten Galeere. Noch waren nicht alle Frauen und Kinder an Bord. Er trieb sie die Schiffsplanke hinauf. »Schneller, schneller!«
Hinter ihm klang Geschrei und er drehte sich um. Mehrere Angreifer versuchten, durch die Reihen der Verteidiger zu brechen. Doch Heinrich und seine Männer drängten sie zurück.
Der Anblick der heranstürmenden Krieger, die Schreie der Frauen und Kinder erinnerten Wilhelm an die mordende Horde, die damals wahllos Muslime abgeschlachtet hatte.
Ist das jetzt die gerechte Strafe?
So Gott es will!
Als hätte sein Bruder seine Gedanken gelesen, hob er sein Langschwert und schrie »DEUS LO VOLT!« Er und seine Männer stürzten sich auf die Angreifer.
Ein letztes Mal ertönte der alte Schlachtruf der Kreuzritter; »DEUS LO VOLT! DEUS LO VOLT!«
»ALLAHU AKBAR!«, brüllten die Angreifer zurück.
Blutüberströmt schwang Heinrich das Langschwert. Mit jedem Schlag stürzte ein Feind zu Boden. Um ihn herum türmten sich die Toten. Ein Nebel hüllte ihn ein, dämpfte das Geschrei. Bis es verstummte und nur die Stahlklinge ihr Todeslied sang.
Vom Fuß der Bootsplanke aus sah Wilhelm dem letzten Kampf seines Bruders zu. Hin- und hergerissen, verzweifelt. Durch den Kampflärm drangen Rufe zu ihm durch.
»An Bord! AN BORD!!«
Hände ergriffen ihn, zerrten ihn die Planke hoch. Kaum war er auf dem Schiff, legte die Galeere vom Landesteg ab, die Planke stürzte ins Wasser.
Wilhelm rannte zum Bug der Galeere, die sich rückwärts immer weiter vom Steg entfernte. Eine Horde Angreifer quoll aus den Gassen hervor und drängte die Kreuzritter zurück. Wie rote Ameisen fielen sie von allen Seiten über die mit Todesverachtung kämpfenden Verteidiger her.
Durch Tränen der Ohnmacht sah Wilhelm, dass einer nach dem anderen vor der Übermacht zu Boden ging. Sein Blick fand Heinrich. Verbissen kämpfte sein Bruder gegen drei, vier Feinde, bis er als Letzter durch einen mächtigen Schwerthieb niedergestreckt wurde. Noch einmal richtete er sich auf und stieß sein Schwert in den Körper des Gegners.
Auf dem Kai zusammengebrochen, wandte Heinrich von Bolanden das von Schmerzen verzerrte Gesicht den Schiffen zu. Seine sterbenden Augen suchten den einsamen Bruder am Bug der letzten ablegenden Galeere.
Ihre Blicke begegneten sich ein letztes Mal.
